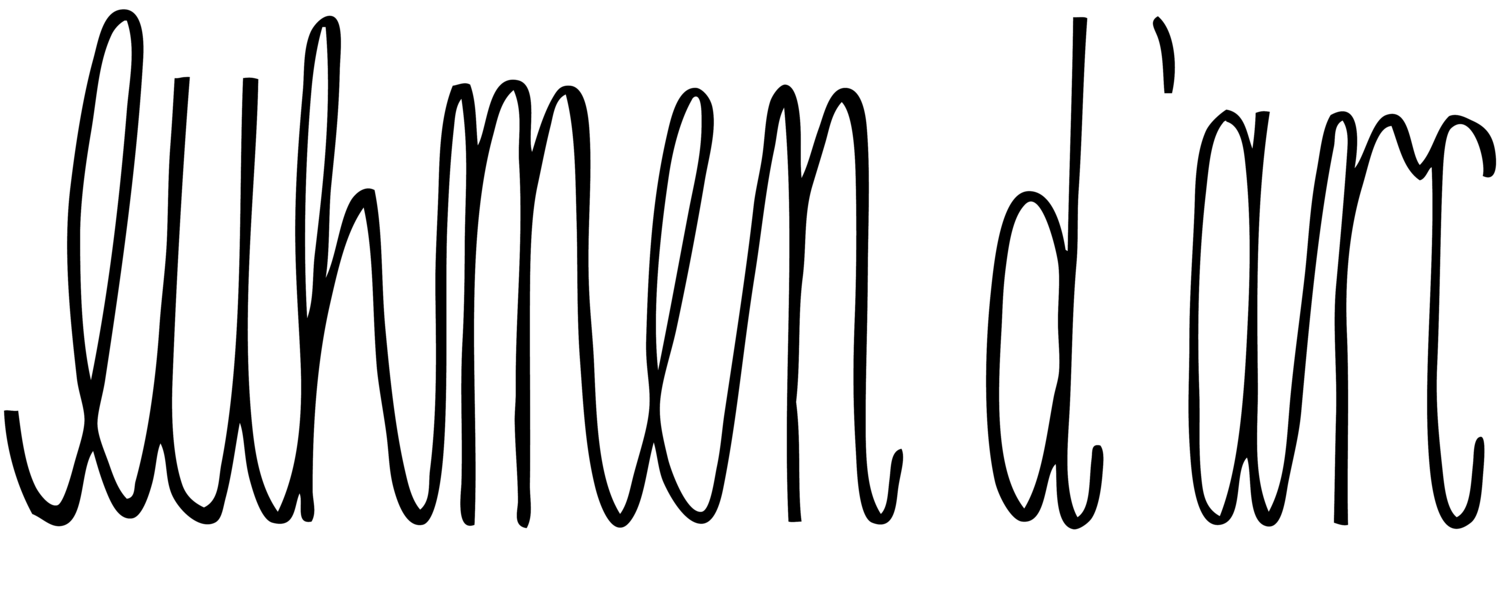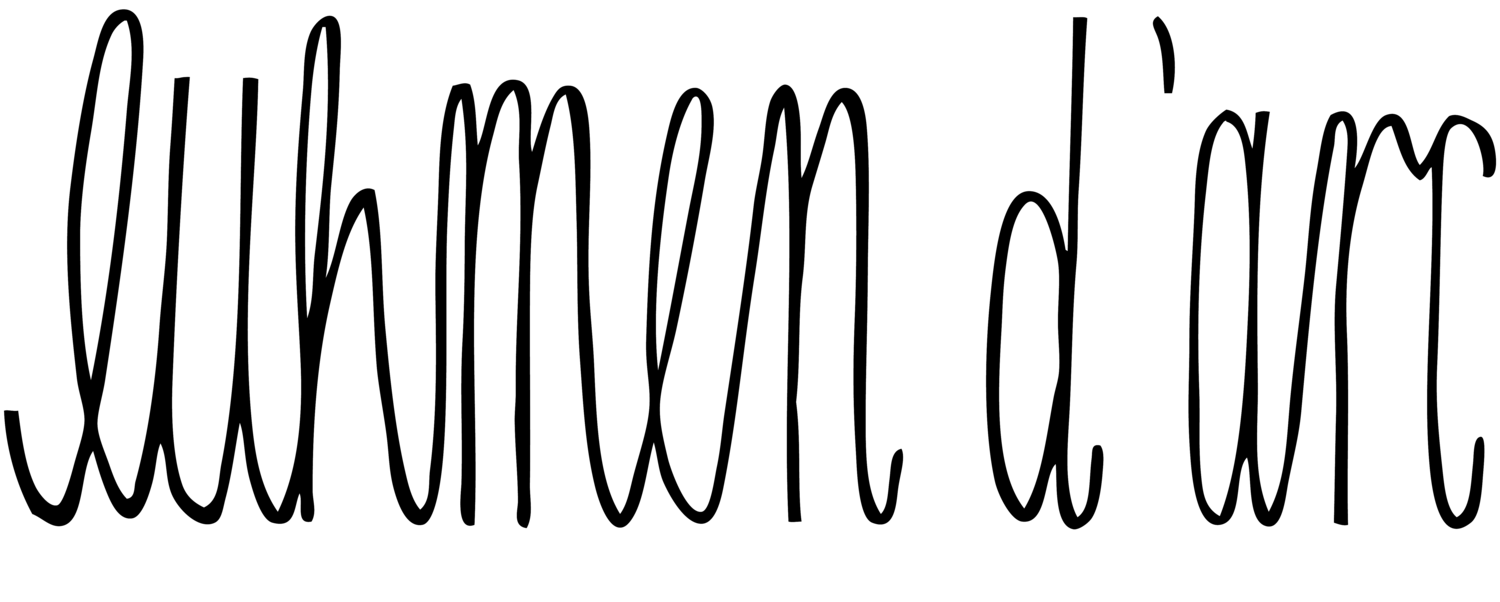Workshopsexualität. Teil I
Partnerschafts-Sexualität funktioniert anders als Casual-Hook-Up-Sexualität. Eine Unterscheidung, die weiterhilft, um Beziehungsprobleme anzugehen und sich Frust zu ersparen, wenn man meint, dass es nach einem Ikea-Besuch mit dem Gatten genauso feurig im Bett zugehen sollte, wie mit einem mysteriösen Typen, den man aus einer Jazzbar mitschleppt. Ebenso funktioniert Jugendlichen-Sexualität anders, als Erwachsenen-Sexualität. Eine Unterscheidung, die weiterhilft, um sein Sexualkundewissen an die neue Lebensphase anzupassen und sich Stress zu ersparen, wenn man meint, dass Körperteile ebenso leicht erigieren und lubrizieren sollten, wie zu Teenagerzeiten.
Beide Differenzierungen erscheinen zunächst selbstverständlich. Na klar, sowie doch auch Hetero-Sexualität anders funktioniert als queere. Je mehr ich aber beobachte und nachdenke, umso mehr fällt mir auf, wie selten jedoch von Sexualitäten – im Plural – gesprochen wird. Meist werden universelle Aussagen getroffen, die die verschiedenen Sexualitäten mit ihren sehr unterschiedlichen Spezifika in einen Topf werfen. Was viele zur Sexual- oder Paartherapie führt ist ja, dass sich Erwachsene an den Sexdefinitionen der Jugend orientieren, weil das die universell geltenden Kriterien für ‚normalen‘ Sex sind – ein schier unerschöpflicher Vorrat an körperlicher Energie und geilmachender Hormone, spontane Schäferstündchen mit no strings attached, straffe Haut,... – und sich einreden, etwas stimme nicht mit ihnen, wenn ihre Körper bei diesen Standards nicht mehr mithalten. Und wer das Sexualverhalten frischer Verknalltheit und abenteuerlicher Impulsivität als Goldstandard setzt, dem erscheint das Einkehren von Ruhe und Routine in langjährigen Beziehungen als Mangel und Problem.
Es macht also Sinn sich zu orientieren und zu verstehen, welche Art von Sexualität man gerade lebt, und diese sowohl als gleichwertig zu den anderen zu betrachten, als auch mit ihren Eigenheiten, Schwierigkeiten und Verheißungen kennenzulernen. Dann lässt sich das Liebesleben seinem jeweiligen Kontext angemessen gestalten und genießen.
Ebenso verhält es sich mit der Art von Sexualität, der in Workshops begegnet wird, und die eigen und anders zu anderen Sexualitäten ist. Allerdings habe ich das so noch nirgends formuliert gefunden: dass es sowas wie Workshops-Sexualität gibt.
Zeit, das nachzuholen.
Was zeichnet Workshop-Sexualität aus?
Das Medium des Workshops ernst zu nehmen heißt, zu verstehen, dass sexpositive Workshops nicht einfach neutrale Behälter sind, in denen sexuelle Themen behandelt werden. So wie jede Form immer auch den Inhalt beeinflusst, verändert die Form „Workshop“ den Inhalt „Sex“. Man könnte noch weiter gehen und die These formulieren: Sex in Workshops wird selber workshopifiziert.
Workshops sind Bildungsräume, in denen Wissen und Techniken im Versuch-und-Irrtum-Verfahren ausprobiert und am eigenen Leib erlebt werden. Es geht also nicht um einseitiges eintrichtern, sondern das Betreten und Bewohnen von ergebnisoffenen Experimentier- und Erfahrungsräumen. Teilnehmende reflektieren das Geschehen im Laufe des Kurses und nehmen unterschiedliches aus ihm mit. Was davon mitgenommen wird, lässt sich allerdings nicht eins zu eins auf workshopexterne sexuelle Sphären importieren. Vielleicht versucht man mit seiner*m Partner*in Sachen, die im Workshop begeistert haben, ist dann aber verwundert, warum das jetzt gar nicht so gut klappt wie im Workshop.
Laut einer Definition auf Wikipedia ist ein „Workshop [...] eine Veranstaltung, in der eine kleinere Gruppe mit begrenzter, kompakter Zeitdauer intensiv an einem meist praxisorientierten Thema arbeitet“. Ein Workshop ist aufbereitet. Er folgt einem Programm und ist in verschiedene Programmpunkte oder Module getaktet. Vor allem aber: Ein Workshop endet. Und zwar bereits nach wenigen Stunden oder Tagen. Diese begrenzte Dauer ermöglicht genau das, was eines der größten Potentiale von Workshops ist: Hier lässt sich etwas wagen! Hier lassen sich Dinge mal ganz anders machen! Hier kann ich zum Beispiel ausprobieren wie es sich anfühlt, wenn andere mich mit they/them ansprechen. Hier kann ich in Rollenspiele mit fremden Menschen schlüpfen, mit denen ich nichts zu verlieren habe, selbst wenn es peinlich wird, weil wir uns danach nie wieder sehen. Es geht um Grenzgänge, das Verlassen bekannter Pfade in einem gehaltenen Rahmen. Werden dann aber Workshopinhalte in langjährige Beziehungen oder andere Formate getragen, verändern sie sich automatisch. Anderes steht auf dem Spiel. Den Partner verunsichert das neue Pronomen vielleicht oder die Rollenspiele bringen unbewusste Beziehungsdynamiken hervor, die danach ganz anders prozessiert werden wollen. Aber da ist kein Facilitator und keine Gruppe mehr, die das mithalten und unterstützen.
Das heißt nicht, dass Versuche der Übersetzung von Workshoperfahrungen in andere Lebensbereiche unterlassen werden sollten, im Gegenteil. Workshopteilnehmende müssten nur mehr darauf vorbereitet werden oder sich darauf einstellen, dass die Eigenheiten der jeweiligen Sphären dabei mitbedacht werden müssen. Zum Beispiel dass Workshop-Sexualität sowohl von kollektiven Unternehmungen und kooperativem Peer-Support ganz bestimmter Leute lebt, als auch neoliberal individualistisch ausgerichtet ist.
Bereits das Wort verrät, dass es sich beim workshoppen um Arbeit handelt. Es ist eine Werkstatt, in der getüftelt und getan wird. In Workshops wird Sex demnach zu etwas, das sich bearbeiten, reparieren, verfeinern lässt. Auch das hat riesiges Potential, da es einen Strich durch die Rechnung macht von vorherrschenden Vorstellungen, in denen Sex einfach von sich aus passieren soll, da es etwas vor allem ,natürliches’ sei, das einem inneren Trieb folge. Workshops sind damit Teil eines emanzipatorischen Projekts: wir sind den Dingen nicht nur ausgeliefert, wir können sie proaktiv gestalten! Das macht Workshops zu einem wundervollen Edelstein, der sich aber ebenso als Stolperstein herausstellen kann. Denn übersehen werden könnten durch diese Empowerment-Haltung beispielsweise all die ebenso wertvollen sexuellen Erfahrungen, in denen Sex eher etwas mit einem tut, als dass man ihn tut. Erfahrungen der Hingabe, des Weggetragenwerdens wie von einer riesigen Welle, werweißwohin. Die in Workshops vorherrschenden Zugänge des Könnens, Beherrschens und Verbesserns kommen nicht heran an diese Seiten, könnten sie auch hemmen. Damit einher geht ein methodischer Individualismus, den Workshops verfolgen. In ihnen agieren wohltemperierte Subjekte, die auf sich und ihr Erleben Zugriff haben durch diverse Selbsttechniken: Sharingrunden, Processing, Reinspüren, Austauschen, Reflektieren, Transparentmachen. Durch das möglichst klare Kommunizieren von Wünschen, Grenzen, Bedürfnissen. Mit diesem Subjektverständnis machen Workshops aus Sex ein optimistisches Projekt. Eine interessante Schule der Queer Theory weist jedoch auf Mängel und Gefahren solcher Versuche einer „auf Erlösung ausgerichteten Neuerfindung des Sex“ hin, in denen „eine verborgene Übereinkunft darüber herrscht, dass Sexualität in ihrem Wesen weniger beunruhigend, weniger sozial aufreibend, weniger gewalttätig ist und die ,Persönlichkeit' mehr respektiert, als sie es bisher war”. Dieses Zitat stammt vom Theoretiker Leo Bersani, der den Begriff des „self-shatterings“ durch Sex geprägt hat, demnach sich das Selbst beim Sex, wie bei anderen Rauscherfahrungen, gewissermaßen auflöst. Workshop-Sexualität hingegen funktioniert nur mit einem intakten Selbst und hört da auf, wo depersonalisierende Intimität beginnt. Da muss ja jemand sein, der das auch souverän anwendet, was man in Workshops lernt. Wenn man sich aber selbst vergisst und verliert (was – je nachdem – eine gruselige, aber auch herrlich exquisite und wohltuende Erfahrung sein kann), dann kann man ja nicht mehr sagen, wo man sich auf dem Wheel of Consent gerade befindet; ob man jetzt dient, nimmt, erlaubt oder empfängt ist dann himmelhochjauchzend egal.
Das führt zum nächsten Spezifikum von Workshops, die sich dadurch auszeichnen, dass sie von jemandem moderiert oder pädagogisch gehalten und damit auch begrenzt werden. Da Workshops nicht nur braver sondern auch safer spaces sind, geht es ihn ihnen vornehmlich um die Verzahnung von Sex mit Verantwortung und konsensuellem Handeln. Workshop-Sexualität bringt eigene Normen, Vorschriften und Regeln mit sich.
Was es damit auf sich hat und was damit einhergeht, lässt sich bald in Teil II lesen...